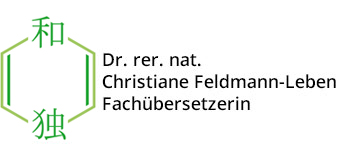In letzter Zeit höre ich öfter, dass Übersetzer einfach keine Ahnung hätten. Was man so von den Agenturen bekäme, sei unbrauchbar. Nun, dass liegt nicht nur an den Übersetzern, eigentlich zum kleinsten Teil. Sondern mehr am System der Agenturen. Natürlich gibt es gute und schlechte, aber Monsteragenturen sind sicher keine Garanten für gute Qualität. Die kleinen, feinen schon eher.
Einer von vielen Gründen für schlechte Qualität sind sogenannte Translation Memories, TMs. TMs sind eine feine Sache. Mit Abstrichen. Für Fachfremde: Ein Translation Memory speichert Übersetzungseinheiten, also beispielsweise einen englischen Satz zusammen mit der deutschen Übersetzung dieses Satzes. Taucht der Satz erneut auf, setzt das Programm die Übersetzung automatisch ein. Vorteil ist mehr Konsistenz. Außerdem kann der Übersetzer in alten Übersetzungen suchen, wie er etwas früher mal übersetzt hat. Was ebenfalls zur Konsistenz beiträgt. Hohe Konsistenz ist schon mal gut für Qualität.
Qualität hat aber einen Preis
Leider haben Agenturen diese schönen Systeme als Kosteneinsparer verkauft und bezahlen 100% Treffer schlecht oder auch gar nicht und zahlen für teilweise Übereinstimmungen deutliche Abschläge, was auch nicht immer gerechtfertigt ist. Im Englischen ist ein Satz, in dem „device“ durch „apparatus“ ersetzt wurde, nicht weiter gravierend. Aber im Deutschen wird aus „DIE Vorrichtung“ „DAS Gerät“, es muss also die Grammatik auch angepasst werden und der vermeintliche 95%-Treffer erfordert sorgfältige Überarbeitung. Was Agenturen dafür zahlen, ist unangemessen wenig. Das verführt offenbar den ein oder anderen zum Schludern. Sorgfalt hat halt ihren Preis.
Besonders haarsträubend ist aber die Praxis, 100%-Treffer (sogenannte matches) gar nicht zu bezahlen. Das führt dazu, dass die Übersetzer diese Sätze gar nicht mehr ansehen. Eventuelle Fehler pflanzen sich von Text zu Text fort, ohne jemals verbessert zu werden. Außerdem lesen Übersetzer häufig gar nicht mehr den vollständigen Text, sondern nur noch die Sätze, die sie bearbeiten. Warum sollten sie auch? Niemand arbeitet gerne für lau. Das kann im Falle des Austauschen von device durch apparatus dann schon mal dazu führen, dass im Folgesatz „Sie“ (die Vorrichtung nämlich) steht, statt „Es“ (wegen „das Gerät“). Ist halt nicht aufgefallen, dass der Satz angepasst werden muss.
Frontlader
Besonders schlimm wird es, wenn die Segmentierung, also das Zerstückeln des Textes in Teile für das TM, nicht vernünftig erfolgt und Kollegen die Segment-Merge-Funktion nicht kennen oder nicht nutzen (dürfen). Das führt zu grammatischen Verwicklungen, die unweigerlich irgendwann zu fehlerhaften Übersetzungen führen. Und dann können auch einzelne Wörter ins TM gelangen, was gefährlich ist. Denn nicht jedes Wort hat nur genau eine Entsprechung. So kam es, dass aus „The creme is applied to the chin, cheek and the front“ Folgendes wurde:
Die Creme wird aufgetragen auf:
Kinn,
Wangen und
Frontlader.
Dem Übersetzer war das allerdings nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil er für den 100%-Treffer nicht bezahlt wurde. Der Revisorin schon, die beharrt auf Zahlung nach Stunde und liest den ganzen Text. Aber es gibt auch Revisoren, die für 100% nicht bezahlt werden. Vergessen Sie also nicht, Pflegecreme auf den Frontlader aufzutragen, wenn Sie sich das nächste Mal eincremen. Cheers!